Am 14. Oktober 2025 erschien im Berchtesgadener Anzeiger ein Artikel, der nicht nur über Gedichte spricht – er ruft zum Aufstand auf. Nicht mit Steinen, nicht mit Sirenen, sondern mit Worten. Denn seit Jahrzehnten ist Poesie in Deutschland kein bloßer Kunstausdruck, sondern eine Waffe der Stille, ein Widerstand, der nicht schreit, aber tief wirkt. Und jetzt, 2025, wird dieser Widerstand wieder laut – in den Straßen, in den Kursen, in den Lesungen. Poesie ist kein Luxus. Sie ist die letzte Form der Wahrheit, die das Regime nicht unterdrücken kann.
Die Wurzeln des Widerstands: 1976 und die DDR
Der Artikel erinnert an einen Moment, der Deutschland veränderte: 1976. Im Westen erschien Reiner Kunzes Wunderbare Jahre, ein Buch, das mit sanfter Ironie die Absurditäten des Lebens in der DDR schilderte. Gleichzeitig wurde Wolf Biermann, der größte Stimme der kritischen Literatur, ausgebürgert – aus der DDR, aus der Heimat, aus dem Leben seiner Fans. Und da erhoben sich nicht nur Politiker, sondern Dichter. Sarah Kirsch, damals noch jung, schrieb nicht nur Gedichte – sie protestierte. Sie sagte später: „Wer Gedichte schreibt, die davon ausgehen, dass die Welt heil ist, streut sich und anderen Sand in die Augen.“ Ein Satz, der heute noch wie eine Warnung klingt. Der Staat reagierte mit Drangsalierungen: Überwachung, Ausstellungsverbote, Berufsverbot. Doch die Gedichte blieben. Sie wurden kopiert, in Kellern gelesen, in Briefen verschickt. Die Poesie überlebte – weil sie nicht aufhören konnte.
Die Erben der Kirsch: Literaturpreise als politische Bekenntnisse
Fast 50 Jahre später, am 4. Juni 2025, wurde in Weimar der Konrad-Adenauer-Stiftung-Literaturpreis verliehen – an Iris Wolff. Die Jury zitierte Kirsch. Nicht als nostalgische Erinnerung, sondern als Leitstern. Der Preis ging auch an Lutz Seiler, dessen Romane Kruso und Stern 111 die letzten Tage der DDR und die chaotische Wende mit poetischer Präzision einfingen. Seiler schreibt nicht über Politik – er schreibt über Menschen, die in ihr ertrinken. Und dann ist da Ulrike Draesner, die 2002 schrieb: „Wir sind hineingeflogen worden in eine Zeit, in der das Beharren auf Kultur wieder nötig sein wird.“ Heute klingt das wie eine Prophezeiung.
Street Art, Montagsdemo und die Sprache der Straße
Die Akademie der Kulturellen Bildung hat 2025 ein Programm herausgebracht, das keine Grenzen kennt: „Kreativer Aufstand oder Poesie des urbanen Raums?“ Street Art wird dort nicht als Graffiti abgetan, sondern als „subversive Kulturpraxis im öffentlichen Raum“. In Stuttgart wurde am 27. Oktober 2025 um 18 Uhr auf dem Schlossplatz eine Montagsdemo abgehalten – nicht gegen die Regierung, sondern für das Recht, zu denken. Kathrin Hartmann, Journalistin und Autorin, sprach von einer „Volkshochschule unter freiem Himmel“. Ein Ort, wo Wahrheit nicht verhandelt wird, sondern gelebt. Sie zitierte Antonio Gramsci: „Optimismus des Willens“. Nicht der Optimismus der Hoffnung – sondern der Mut, weiterzumachen, selbst wenn alles gegen dich steht.
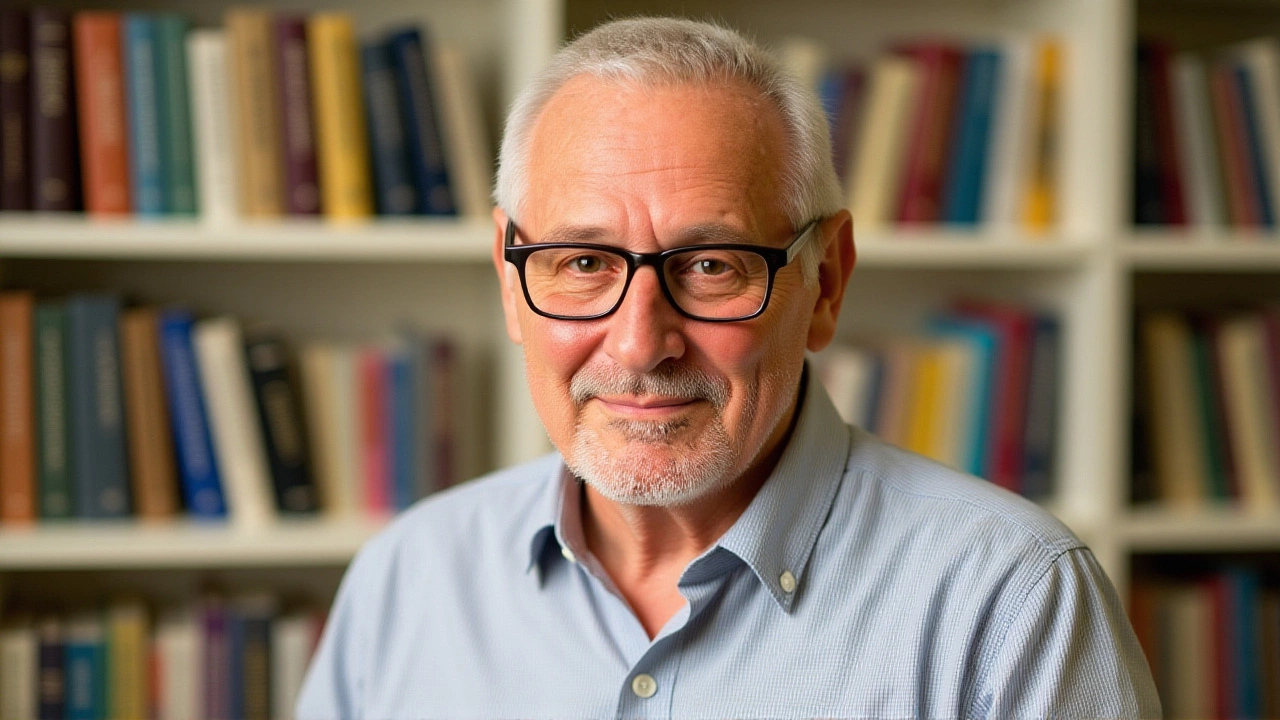
Der 3. Oktober: Eine bundesweite Stimme für den Frieden
Und dann kommt der 3. Oktober 2025. Nicht der Tag der Deutschen Einheit – sondern der Tag, an dem Tausende in Berlin und Stuttgart auf die Straße gehen, nicht mit Fahnen, sondern mit Gedichten. Die Initiative „Nie wieder Krieg – die Waffen nieder!“ ruft auf: „Nie wieder kriegstüchtig! Stehen wir auf für Frieden!“ Die Vorbereitung begann am 25. Juli 2025 mit einer Online-Aktionsberatung. Newsletter wurden an Zehntausende verschickt – kein Werbematerial, sondern poetische Appelle. Ein Text von Jari Ortwig, der in einem Kurs der Akademie gelesen wird, sagt: „Aufhören im Sinne des Aufhorchens.“ Nicht aufgeben. Aufhorchen. Das ist der Kern.
Warum das alles jetzt wichtig ist
Es ist kein Zufall, dass all dies im Jahr 2025 zusammenkommt. In einer Zeit, in der Algorithmen die Gedanken steuern, in der politische Reden aus Leerformeln bestehen, in der Krieg wieder in Europa Einzug hält – brauchen wir Menschen, die Worte nicht nur sprechen, sondern bewahren. Sarah Kirsch starb 2013. Aber ihre Worte leben. Lutz Seiler schreibt über die Mauer, die nicht nur aus Beton bestand. Ulrike Draesner sagt: Kultur ist kein Überfluss. Sie ist die Luft, die wir atmen, wenn andere sie abdrehen.

Was bleibt? Die Stille, die laut ist
Manchmal ist der lauteste Protest nicht der mit dem Megafon. Manchmal ist er ein Gedicht, das jemand in der U-Bahn liest. Ein Wandgemälde, das niemand unterschrieben hat. Ein Brief, der nie versandt wurde – aber gelesen wurde. Die Poesie ist kein Ausweg. Sie ist der Weg. Und sie hat nie aufgehört, zu sprechen.
Frequently Asked Questions
Warum ist Sarah Kirsch heute noch relevant?
Sarah Kirsch bleibt relevant, weil sie die Illusion der Heiligkeit der Welt entlarvt hat – ein Blick, der heute dringender ist denn je. Ihre Gedichte verweigern sich der Sentimentalität und fordern stattdessen Nachdenklichkeit. In einer Zeit, in der soziale Medien emotionale Oberflächen produzieren, ist ihre antiidyllische Haltung ein Gegenmittel. Ihre Aussage „Sand in die Augen streuen“ beschreibt perfekt, wie wir uns heute oft selbst täuschen – mit Schönrederei statt Wahrheit.
Wie verbindet sich Street Art mit Poesie?
Street Art ist Poesie ohne Buchstaben – sie nutzt Farbe, Form und Raum, um Emotionen und Kritik zu transportieren. Beide Formen brechen die Regeln des Offiziellen. Wo ein Gedicht einen Satz in einen öffentlichen Raum setzt, setzt ein Wandgemälde ein Bild. Die Akademie der Kulturellen Bildung versteht beide als „subversive Kulturpraxis“, weil sie den öffentlichen Raum neu besetzen – nicht mit Werbung, sondern mit Bedeutung. Beide fordern: Schau hin. Denk nach.
Was hat die Konrad-Adenauer-Stiftung mit politischem Protest zu tun?
Obwohl die Stiftung als konservativ gilt, verleiht sie seit Jahren Literaturpreise an Autoren, die genau das Gegenteil von Konformität verkörpern – wie Lutz Seiler oder Ulrike Draesner. Die Jury wählt nicht nach politischer Linie, sondern nach sprachlicher Wucht und gesellschaftlicher Relevanz. Sie erkennt: Wahrheit ist nicht parteiisch. Wer mit Sprache die Wirklichkeit benennt, wird unabhängig von seiner Herkunft zum politischen Akteur – und das ist die Stärke der Stiftung.
Warum findet die Demonstration am 3. Oktober statt – und nicht am 9. November?
Der 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit – ein Feiertag, der oft als Symbol für nationale Harmonie missbraucht wird. Die Initiative wählt ihn gezielt, um zu zeigen: Einheit bedeutet nicht Schweigen. Sie will die Erinnerung an die Friedensbewegung der 80er Jahre wiederbeleben, die damals auf dem Schlossplatz in Stuttgart und anderen Plätzen gegen Waffenrüstung protestierte. Der 3. Oktober wird so zum Tag des aktiven Friedens – nicht des feierlichen Vergessens.
Wie viele Menschen werden an der Demonstration am 3. Oktober teilnehmen?
Offizielle Zahlen gibt es noch nicht – aber die Newsletter der Initiative „Nie wieder Krieg“ wurden an über 120.000 Menschen verschickt, und die Online-Aktionsberatung vom 25. Juli zählte über 8.000 Teilnehmer. Die Vorbereitung erfolgt dezentral, mit lokalen Gruppen in 47 Städten. Die Organisatoren rechnen mit mindestens 50.000 Teilnehmern in Berlin und Stuttgart zusammen – und mit Hunderten von Lesungen, Gedichtwänden und stillen Protesten in Kleinstädten, die nicht in den Medien stehen, aber genau dort zählen.
Was bedeutet „Aufhören im Sinne des Aufhorchens“?
Es ist ein Wortspiel, das Jari Ortwig aus der Sprache der Gewalt nimmt und sie in eine Haltung der Achtsamkeit verwandelt. Statt „aufhören“ als Kapitulation zu verstehen, bedeutet es: innehalten. Lauschen. Nicht mehr schreien, sondern hören. In einer Zeit, in der alle nur noch ihre Position verteidigen, ist das revolutionär. Es ist die Grundlage jeder echten Demokratie – und jeder echten Poesie. Wer aufhört zu reden, um zuzuhören, hat die Macht der Worte wiederentdeckt.



